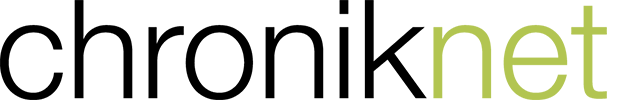Arbeit und Soziales 1971:
Der seit Ende der 60er Jahre anhaltende konjunkturelle Aufschwung lässt die Arbeitsmarktsituation in der Bundesrepublik – vor allem im internationalen Vergleich – weiterhin günstig erscheinen. Allerdings flaut das Hoch der vergangenen Jahre ab: Steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Erwerbstätigkeit kennzeichnen die Entwicklung gegenüber 1970. Der Anhebung der Löhne und Gehälter steht eine verhältnismäßig hohe Steigerungsrate bei den Lebenshaltungskosten gegenüber. Fortschritte sind auf sozialem Gebiet zu verzeichnen: Die geplanten »inneren Reformen« der Regierung Brandt/Scheel, die seit 1969 am Ruder sitzt, nehmen konkretere Formen an (<!– –>24.3.<!– –>).
1971 steigt die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik im Vergleich zu 1970 um 24% auf 185000. Die Arbeitslosenquote beträgt mittlerweile 0,8%. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt geringfügig ab: Sie sinkt um 0,1% auf 26650000. Auch die Anzahl der offenen Stellen ist gegenüber dem Vorjahr von 795 000 Stellen auf 648 000 zurückgegangen.
Im internationalen Vergleich 1971 schneidet die Bundesrepublik gut ab. Von den zehn reichsten Industrieländern der Welt besitzt sie die geringste Arbeitslosenquote. Auch die Steigerungsrate fällt hier mit 24,2% relativ gesehen niedrig aus. Die größten Beschäftigungsprobleme haben Kanada mit einer Arbeitslosenquote von 6,4% und die USA mit 5,7%. Sie resultieren aus der insgesamt schlechten wirtschaftlichen Situation dieser Staaten. Einen überdurchschnittlich großen Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr weist Schweden mit 236,7% auf.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt spielt 1971 in der Bundesrepublik eine eher untergeordnete Rolle. Die öffentliche Diskussion wird von einem anderen Thema beherrscht: Die hohe Steigerungsrate bei den Lebenshaltungskosten. Sie beträgt durchschnittlich 5,1%. So erhöhen sich die Ausgaben eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalts um 5,4,%. Vor allem die Preise für Nahrungsmittel werden enorm angehoben. Ein Liter Vollmilch verteuert sich z.B. um 116,2% auf 0,80 DM (<!– –>1.2.<!– –>). Die von Gewerkschaften und Arbeitgebern in den Tarifverhandlungen ausgehandelten Lohnerhöhungen von durchschnittlich 11,0% werden auf diese Weise erheblich beschnitten.
Frischer Wind weht 1971 in der Bundesrepublik auf sozialem Gebiet. Der von der SPD/FDP-Koalition seit 1969 propagierte Ausbau der sozialen Sicherung wird in Teilbereichen bereits umgesetzt.
So tritt z.B. das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in Kraft (<!– –>1.9.<!– –>). Der Bonner Bundestag verabschiedet 1971 auch eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952. Dadurch werden die Rechte der Arbeitnehmer in den Betrieben erweitert (<!– –>10.11.<!– –>).
Ebenfalls vom Bundestag verabschiedet wird das »Wohnungsbauänderungsgesetz«. Es setzt die Einkommensfreigrenze für den Bezug von Sozialwohnungen herauf.
Fortschritte verzeichnet die Bundesregierung 1971 auch hinsichtlich der geplanten Reform der Rentenversicherung. Ein von Arbeitsminister Walter Arendt vorgelegtes Fünf-Punkte-Programm sieht folgende Maßnahmen vor:
- Einführung einer flexiblen Altersgrenze
- Individuelle Anhebung von Kleinrenten
- Einführung eines Baby-Jahres für versicherte Frauen
- Öffnung der Rentenversicherung für Hausfrauen
- Regelung des Versorgungsausgleichs bei Scheidungen.
Der von der Bundesregierung am 20. Oktober 1971 verabschiedete Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung greift diese Vorschläge des Arbeitsministers auf.
Bereits im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Rentenversicherung wird deutlich, dass den Frauen 1971 in der Bundesrepublik verstärkte Aufmerksamkeit zukommt. Auch an anderen Stellen wird auf die Situation der Frau – vor allem im Berufsleben – mit Nachdruck hingewiesen. Das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften (WWI) erstellt eine Studie »über quantitative Aspekte der Frauenarbeit in der Volkswirtschaft«. Ergebnis: Zwar sind ein Drittel aller Erwerbstätigen Frauen, doch erhalten sie nur ein Viertel der Bruttolohn- und Gehaltssumme.
Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen verdienen Frauen durchschnittlich weniger. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass in den sog. typischen Frauenberufen, wie z.B. Krankenschwester, von vornherein niedrigere Gehälter gezahlt werden. Auch sitzen weit weniger Frauen als Männer in gehobenen Positionen. Andererseits werden jedoch weibliche und männliche Arbeitskräfte für die gleiche Arbeit immer noch unterschiedlich bezahlt.
Die schlechtere berufliche Stellung der Frau drückt sich auch in den tariflichen Bruttostundenlöhnen der Industrie aus. Der Lohn eines Facharbeiters beträgt z.B. 7,25 DM, der einer Facharbeiterin aber nur 5,05 DM. Immerhin ist dieser Lohn bei den Frauen im Vergleich zum Vorjahr um 12,5% gestiegen, bei den Männern aber nur um 11,7%.
Umfragen versuchen dem Grund der unterschiedlichen Behandlung von Mann und Frau in der Arbeitswelt nachzugehen. Nach wie vor wirken sich Haushalt und Kinder »wie ein Klotz am Bein« aus und reduzieren die beruflichen Möglichkeiten der Frauen. Auch stoßen weibliche Erwerbstätige im Berufsalltag nach ihren eigenen Erfahrungen weiterhin auf erheblichen Widerstand bei männlichen Kollegen und Vorgesetzten.
![Jim Irwin mit dem Lunar Roving Vehicle der Apollo-15-Mission. By NASA/David Scott [Public domain], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2015/12/1200px-Apollo_15_Lunar_Rover_and_Irwin-300x225.jpg)
![Finlandia-Halle, Helsinki. By Thermos (Self-published work by Thermos) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2017/01/1025px-Finlandia_Wiki-300x263.jpg)
![Willy Brandt (1980), Bundesarchiv, B 145 Bild-F057884-0009 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2015/09/Bundesarchiv_B_145_Bild-F057884-0009_Willy_Brandt1-213x300.jpg)
![Transitabkommen 1971, unterzeichnet von Egon Bahr (links) und Michael Kohl (rechts) Foto: Hubert Link. Bundesarchiv, Bild 183-K1211-0014 / Link, Hubert / CC-BY-SA [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2015/09/Bundesarchiv_Bild_183-K1211-0014_Berlin_Transitabkommen_Paraphierung-300x159.jpg)
![Erich Honecker (1976), Bundesarchiv, Bild 183-R1220-401 / Unknown / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2015/09/Bundesarchiv_Bild_183-R1220-401_Erich_Honecker-e1441092793887-297x300.jpg)
![Das historische Blue Marble Foto von 1972, das half, Umweltschutz der breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen. By NASA/Apollo 17 crew; taken by either Harrison Schmitt or Ron Evans [Public domain], via Wikimedia Commons](https://chroniknet.de/extra/wp-content/uploads/2015/09/899px-The_Earth_seen_from_Apollo_17-300x300.jpg)